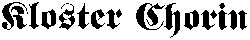
IM 13. JAHRHUNDERT - EIN NEUER ANFANG
Am 8. September 1273 sind auf der Burg Werbellin die drei
Markgrafenbrüder Johann IV., Otto II. und Konrad I. und etliche
Zeugen wie Ritter Günther Graf zu Ruppin, Ritter Bertram von
Beenz, Georg von Kerkow sowie Johann von Wustrow versammelt.
Sie gaben die Erlaubnis zur Verlegung des Zisterzienserklosters
von Mariensee nach Chorin. Dies wird für alle Ewigkeit auf
Pergament beurkundet, welches uns dadurch bis heute überliefert ist.
Die drei Markgrafen entsprechen damit der Bitte der drei
erschienenen Äbte Heinrich Abt von Lehnin, Hermann Abt von
Kolbatz und Heinrich Abt von Chorin sowie Ihrer Ordens- brüder,
das von ihrem Vater Johann und ihrem Onkel Otto auf der Insel im
Parsteiner See gegründete Kloster wegen der dortigen
Unbequemlichkeiten an einen geeigneteren Ort zu verlegen. -
Dieser Ort ist Chorin, das Kloster erhält den gleichen Namen.
Alle Schenkungen gehen von Mariensee an Chorin über.
Gleichzeitig wird ihnen an diesem Tag das Dorf Ragösen mit 26 Hufen
und allen Zubehörungen geschenkt.
Die Zisterzienser dürfen laut Ordensverfassung Felder, Wiesen,
Äcker, Weinberge, Seen und Höfe für die Eigenversorgung
besitzen. Sie wurden bei allen Stiftungen bestens damit
ausgestattet, so daß die Versorgung des Klosters gesichert war.
Nach der 1273 ausgefertigten Urkunde waren dies Schenkungen von
1258 mit den Dörfern Pehlitz, Plawe, Brodowin und Chorin, dazu
einige Seen, Wälder, das Hospital in Oderberg, die Ragöser Mühle,
viele Hufen und Wiesen. Bestätigt wird ihnen Zollfreiheit in der
ganzen Mark für den eigenen Bedarf an Kleidung und Nahrungsmitteln.
Interessant ist, daß die Urkunde vom Abt zu Chorin spricht, den
es eigentlich noch nicht geben dürfte. Schon am 8. Februar
nimmt auch Papst Gregor X. in Lyon das Zisterzienserkloster
Chorin mit allen seinen Besitzungen auf und bestätigt es. Auch
Hermann und Heinrich, Bischöfe zu Kammin, bestätigen bereits 1270 dem
Kloster Chorin den Zehnten von 120 Hufen im neumärkischen Streubesitz.
Offensichtlich war es ein längerer, andauernder Vorgang und man
begann schon viel früher mit dem Bau in Chorin, also ohne
offizielle Baugenehmigung. So lässt sich auch erklären, daß
der Bau Kloster Chorin schon um 1300 fertig war, was 1273
beginnend nicht möglich gewesen wäre. Immer begann man beim
Bauen mit dem Chorteil im Osten, um den Gebetsraum für die
Mönchsgemeinschaft zu haben. Es folgten die Unterkünfte und
wichtigsten Funktionalräume im Ost- und Südflügel, wozu
Sakristei, Kapitelsaal, Speisesaal und Schlafsaal gehörten.
Alles fehlt heute in Chorin. Der heute noch in Chorin vorhandene
sogenannte Fürstensaal verbindet den zuletzt gebauten Westteil
der Kirche mit dem Konversenflügel. Als Abschluss wurde die
Schaufassade vor die Kirche gesetzt und das Kirchenschiff
eingewölbt. |
|

 |